Leitbild der Freien Berufe in Niedersachsen
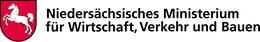

1. Bedeutung der Freien Berufe in Niedersachsen
Freie Berufe sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Es gibt in Deutschland rund 1,47 Mio. selbstständige Freiberuflerinnen und Freiberufler.1 Deutschlandweit beschäftigen diese 4,65 Mio. Menschen. Dies sind doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Gemeinsam mit ihren Teams erwirtschaften die selbstständigen Freiberuflerinnen und Freiberufler 513 Mrd. Euro Jahresumsatz und steuern 10,1 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. In Niedersachsen sind rund ein Fünftel der Selbstständigen (64.945) und ein Zehntel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (386.467) bei den Freien Berufen tätig.2 Freie Berufe bilden zentrale Bereiche wie Gesundheit, Recht, Wirtschaftsberatung, Bau- und Planungskultur und Technik ab. Kanzleien, Praxen oder Büros sind oft fest in ihrem sozialen Umfeld vor Ort verwurzelt und schaffen dort Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Insbesondere in ländlichen Regionen sind sie unverzichtbare Ankerpunkte für die Daseinsvorsorge.
Wie alle Wirtschaftsbereiche befinden sich auch die Freien Berufe in einem gravierenden Transformationsprozess: Zu den allgemeinen aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen (Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Nachwirkungen der Corona-Pandemie, geopolitische Herausforderungen) treten noch spezifische Themen hinzu: Auch die fachlichen Herausforderungen werden immer komplexer, die Abgrenzung zu gewerblichen Interessen wird schwieriger, das Verhältnis von Angestellten und Selbstständigen ändert sich zulasten der Selbstständigen. Diese sind in Niedersachsen in den Freien Berufen im Bundesvergleich ohnehin unterdurchschnittlich vertreten.
Bereits seit längerem ist zu beobachten, dass der europäische Binnenmarkt die Freien Berufe besonders herausfordert: Druck zur Deregulierung, etwa im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie, kann dazu führen, dass Standards gesenkt werden und damit die besondere Stellung der Freien Berufe geschwächt wird. In der EU-Dienstleistungsrichtlinie findet sich kein besonderes Kapitel zu den Freien Berufen. Zudem sind die Freien Berufe eine Besonderheit, die kaum ein anderes europäisches Land kennt. Dementsprechend wundert es nicht, wenn die Kommission oft keinen Grund für eine Differenzierung zwischen Freien Berufen und allgemeinen Dienstleistungen sieht. Die Besonderheiten des Berufsstandes der Freien Berufe, etwa die hohen Ausbildungsstandards oder die Selbstverwaltung, werden von der EU nur unzureichend gewürdigt.
Vor diesem Hintergrund haben der Verband der Freien Berufe im Lande Niedersachsen e. V. (FBN) und das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen vereinbart, dieses gemeinsame Leitbild zu erarbeiten. Es soll als Orientierungshilfe und gemeinsames Wertefundament dienen, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich zu meistern. Gleichzeitig soll die gesellschaftliche Bedeutung der Freien Berufe stärker ins Bewusstsein gerückt werden.
1 Quelle: Bundesverband der Freien Berufe (BFB) e. V./Institut für Freie Berufe (IFB)
2 Quelle: FBN e.V.
2. Grundprinzipien und Selbstverständnis der Freien Berufe
Die Freien Berufe im Lande Niedersachsen bilden eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft und Wirtschaft. Sie stehen für Kompetenz, Verantwortung und Unabhängigkeit und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Lebensqualität der Menschen. Die Freien Berufe basieren auf einem gemeinsamen Fundament von Werten und Prinzipien, die ihre berufliche Tätigkeit prägen. Diese Werte sind nicht nur der Schlüssel für die hohe Qualität ihrer Dienstleistungen, sondern auch für das Vertrauen, das sie bei Auftraggeberinnen/Auftraggebern, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten und der Gesellschaft genießen. Freie Berufe vereinen eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern, darunter Heilberufe, rechts- und wirtschaftsberatende Berufe, technisch-naturwissenschaftliche Berufe sowie Kultur- und Kreativberufe.3 Gemeinsam zeichnen sie sich durch besondere Merkmale aus. Die Legaldefinition des § 1 Absatz 2 Satz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes fasst diese wie folgt zusammen: „Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt.“
2.1 Beitrag zur Daseinsvorsorge/Interessen der Allgemeinheit
Freie Berufe erbringen zumeist Dienstleistungen, die auch im Allgemeininteresse liegen. Freie Berufe verbinden daher wirtschaftliche Tätigkeit mit gesellschaftlicher Verantwortung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge gerade im ländlichen Raum. Ohne Freie Berufe können unsere modernen Gesellschaften nicht funktionieren. Freiberuflich Tätige erbringen Dienstleistungen immer für die Auftraggeberinnen/Auftraggeber, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten. Angehörige freier Berufe sind keine bloßen Dienstleister auf Abruf, sondern handeln innerhalb eines klar definierten Rahmens und erfüllen einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. Die heilkundlichen Berufe sichern die Gesundheit der Bevölkerung und Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure sind nicht nur für die Standsicherheit der Gebäude verantwortlich, sie sind in Zeiten des Klimawandels auch wichtige Akteurinnen und Akteure beim Klimaschutz. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind ein wesentliches Organ der Rechtspflege; eine funktionsfähige Rechtspflege wäre ohne ihre Mitwirkung nicht möglich. Steuerberaterinnen und Steuerberater erfüllen staatliche Aufgaben und tragen dazu bei, dass dem Staat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Diese beispielhafte Aufzählung zeigt, Freie Berufe bieten Dienstleistungen an, die in Teilen als öffentliche Güter betrachtet werden können und die verschiedene externe Effekte erzeugen, die über die direkten Dienstleistungsempfängerinnen oder -empfänger hinausgehen.
Schließlich übernehmen auch Freiberuflerinnen und Freiberufler Verantwortung als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, Ausbilderin oder Ausbilder und Akteurin oder Akteur im öffentlichen Leben und damit auch eine Vorbildfunktion.
3 § 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Einkommensteuergesetz: „Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe.“
2.2 Unabhängigkeit
Die Unabhängigkeit ist ein zentrales Merkmal der Freien Berufe: Freiberuflich Tätige agieren eigenverantwortlich und fachlich unabhängig. Dies gewährleistet eine neutrale, am Wohl der Auftraggeberinnen/Auftraggeber, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten orientierte Tätigkeit, bei der die Fachlichkeit im Vordergrund steht. Die Freien Berufe erbringen persönliche Dienstleistungen, und diese Dienstleistungen können nur auf der Grundlage eines besonderen Vertrauensverhältnisses erbracht werden. Das gilt im heilkundlichen Bereich genauso wie im rechtsberatenden Bereich und auch beim Bau eines Hauses oder einer Brücke, um nur einige Beispiele zu nennen. Freie Berufe stehen an der Seite ihrer Auftraggeberinnen/Auftraggeber, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten und unterstützen gleichzeitig gesellschaftliche Ziele. Die Ausübung Freier Berufe basiert auf persönlichem Einsatz und direktem Kontakt zu den Empfängerinnen/Empfängern ihrer Dienstleistungen. Freiberuflerinnen und Freiberufler halten dabei sowohl allgemeine ethische als auch berufsspezifische Standards ein. Ihre Tätigkeit dient der bestmöglichen Unterstützung ihrer Auftraggeberinnen/Auftraggeber, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten.
Der überwiegende Teil der freiberuflichen Tätigkeiten ist in eigenen Berufsgesetzen festgelegt. Diese Gesetze regeln den Zugang zu Berufen wie den Heilberufen, den (rechts-)beratenden Berufen oder den bauplanerischen Berufen sowie die Voraussetzungen, unter denen eine Beteiligung an Berufsgesellschaften möglich ist. Dies unterscheidet freiberuflich Tätige von Angehörigen anderer Berufsgruppen und ist ein wesentliches Element, um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten. Hierzu gehört auch die durch starke Kammern gewährleistete berufsständische Selbstverwaltung.
2.3 Qualifikation und Kompetenz/Qualität
Freiberuflich Tätige haben in der Regel ihre hohe berufliche Kompetenz durch die gesetzlich vorgeschriebene fachliche Qualifizierung nachgewiesen, und sie bilden sich während des gesamten Berufslebens fort. Eine hohe fachliche Qualifikation und kontinuierliche Weiterbildung sind essenziell für die Qualität ihrer Berufsausübung und das Vertrauen, das in die Freien Berufe gesetzt wird. Ob es beispielsweise die Ärztin oder der Arzt ist, die/der eine Patientin/einen Patienten behandelt, die Architektin oder der Architekt, die/der Häuser plant oder die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt, die/der die Mandantin/den Mandanten in schwierigen Situationen berät, Qualität ist der Maßstab, an dem die Freien Berufe gemessen werden:
- Hohe Standards: Strenge Ausbildungsvorgaben, kontinuierliche Weiterbildung und fachliche Expertise gewährleisten exzellente Leistungen.
- Kundenzufriedenheit: Die Orientierung an den Bedürfnissen und Erwartungen der Auftraggeberinnen/Auftraggeber, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
- Fachkompetenz und Vertrauen: Die Verlässlichkeit der Freien Berufe und ihrer Expertise sind wesentlich.
2.4 Selbstverwaltung
Freiberufliche Tätigkeiten unterliegen oft der Selbstverwaltung durch Kammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Dies ist Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips und entlastet den Staat. Die Aufgaben der Kammern reichen von der Vertretung der berufsständischen Interessen der Mitglieder und der Förderung der beruflichen und wirtschaftlichen Belange über die Fortentwicklung des Berufsrechts bis hin zur Fort- und Weiterbildung der Angehörigen des jeweiligen Berufsstandes. Die ehrenamtlich besetzten Kammergremien ermöglichen ein Höchstmaß an berufspolitischer Expertise und gewährleisten auch das Einbringen berufspraktischer Erfahrungen. Die Kammern stellen aber nicht nur eine hohe Kompetenz bei der Leistungserbringung sicher. Sie sind Ansprechpartnerinnen, wenn eine Auftraggeberin/ein Auftraggeber, Patientin/ Patient, Mandantin/Mandant oder Klientin/Klient unzufrieden sein sollte und sich beschweren möchte. Kammern sind damit auch Orte des Verbraucherschutzes, indem sie für die Durchsetzung des Berufsrechts und dafür sorgen, dass berufsrechtliche Verstöße sanktioniert werden.
3. Herausforderungen und Chancen der Freien Berufe im Lande Niedersachsen
Die Freien Berufe in Niedersachsen stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sich aus gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ergeben. Gleichzeitig eröffnen sich auch Chancen, die es zu nutzen gilt. Nachfolgend werden die zentralen Herausforderungen und Perspektiven beschrieben.
3.1 Demografischer Wandel
Der demografische Wandel stellt die Freien Berufe vor wesentliche strukturelle Veränderungen:
- Herausforderungen:
- Alternde Gesellschaft: Die wachsende Anzahl älterer Menschen erhöht die Nachfrage nach Dienstleistungen, insbesondere in Gesundheitsberufen und beratenden Berufen bei gleichzeitigem Rückgang der Erwerbsbevölkerung.
- Nachfolgeproblematik: Viele freiberuflich Tätige stehen vor der Herausforderung, geeignete Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden.
- Chancen:
- Die Nachfrage nach Leistungen Freier Berufe steigt aufgrund der alternden Bevölkerung,
z. B. in den Gesundheitsberufen oder beim barrierefreien Bauen. - Zuwanderung und Integration ausländischer Fachkräfte können die Auswirkungen des demografischen Wandels abmildern.
- Die Nachfrage nach Leistungen Freier Berufe steigt aufgrund der alternden Bevölkerung,
- Perspektiven:
- Nachwuchsförderung kann mit guten Instrumenten gelingen.
- Persönliche und auch bauliche Unterstützung von Älteren erschließt zusätzliche Kundengruppen.
- Freie Berufe bieten individuelle Lösungen, die Großunternehmen nicht bereitstellen können.
3.2 Fachkräftesicherung/Gründungen
Die Nachwuchsförderung und eine stabile Gründungsdynamik in den Freien Berufen sind zentrale Themen:
- Herausforderungen:
- Wahrnehmung der freiberuflichen Tätigkeit als arbeitsintensiv und wenig lukrativ im Vergleich zu anderen Karrieremöglichkeiten.
- Junge Menschen bevorzugen flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice.
- Besonders in ländlichen Regionen fehlen qualifizierte Fachkräfte.
- Mangelnde Kenntnis über die Vielfalt und Bedeutung der Freien Berufe bei jungen Menschen.
- Sicherstellung auskömmlicher Honorare der freiberuflich Tätigen muss ebenso gewährleistet sein wie die Finanzierbarkeit der Honorare durch ihre Auftraggeberinnen/Auftraggeber, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten, Klientinnen/Klienten oder die Krankenkassen.
- Chancen:
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice sind in einigen Bereichen der Freien Berufe (z. B. bei Architektinnen/Architekten, Ingenieurinnen/Ingenieuren, Rechtsanwältinnen/ Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüferinnen/Wirtschaftsprüfern, Steuerberaterinnen/Steuerberatern) zunehmend möglich.
- Beitrag zu gesellschaftlichen Zielen, wie z. B. Klimaschutz oder Gesundheitsförderung, bietet eine in hohem Maße sinnstiftende Arbeit.
- Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen als wichtiges Instrument zur beruflichen Integration ausländischer Fachkräfte; die Anerkennungsverfahren sind etabliert und kontinuierlich verbessert worden.
- Perspektiven:
- (Insbesondere) junge Menschen wissen um die gesellschaftliche Bedeutung und die berufliche Erfüllung in Freien Berufen.
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
- Aufbau von Netzwerken und Mentoring-Programmen für junge Menschen, die sich in einem Freien Beruf selbstständig machen wollen, durch die Kammern.
3.3 Digitalisierung/KI
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt der Freien Berufe grundlegend: Steuerberaterinnen/Steuerberater und Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte begleiten Unternehmen bei der Einführung digitaler Tools, die Gesundheitsberufe treiben die digitale Gesundheitsversorgung vor- an. Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure legen das Grundgerüst für Datenmodelle im Bauprozess. Auch die Freien Berufe verändern sich durch die Nutzung der Digitalisierung.
- Herausforderungen:
- Datenschutz und Datensicherheit: Umgang mit sensiblen Informationen.
- Risiko des Verlusts der persönlichen Bindung in der Beratung oder Behandlung. Aufrechterhaltung der persönlichen Leistungserbringung trotz zunehmender digitaler Abarbeitung muss gewährleistet bleiben.
- Anpassung an neue Technologien und ständige Weiterbildung.
- Chancen:
- Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung durch digitale Arbeitsprozesse und Automatisierung. Dadurch kann sich ein Produktivitätseffekt ergeben, der auch den Fachkräftemangel teilweise kompensiert.
- Neue Möglichkeiten für den Zugang zu Auftraggeberinnen/Auftraggebern, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten, z. B. durch Telemedizin, Online-Beratungen oder digitale Plattformen.
- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit durch digitale Tools.
- Für den Zugang zu Dienstleistungen der Freien Berufe im ländlichen Raum bietet die Digitalisierung neue Möglichkeiten.
- Perspektiven:
- Freie Berufe sind Treiber moderner Technologien und sichern deren Anwendung in der Breite der Gesellschaft.
- Künstliche Intelligenz kann eine wertvolle Unterstützung bei der Erbringung von Dienstleistungen sein.
- Entwicklung von branchenspezifischen digitalen Strategien.
- Investitionen in IT-Sicherheit und digitale Kompetenzbildung.
3.4 Rechtliche und politische Rahmenbedingungen
Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Freien Berufe stark:
- Herausforderungen:
- Europäischer Binnenmarkt: Druck zur Deregulierung, etwa im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie, kann dazu führen, dass Standards gesenkt werden und damit die besondere Stellung der Freien Berufe geschwächt wird. Die EU-Kommission sieht oft keinen Grund für eine Differenzierung zwischen Freien Berufen und gewerblichen Tätigkeiten, u. a. da in der EU-Dienstleistungsrichtlinie kein besonderes Kapitel zu den Freien Berufen vorhanden ist.
- Bürokratische Hürden und Erfüllungsaufwand schränken den Handlungsspielraum der Freien Berufe ein. Zeit, die für Bürokratie aufzuwenden ist, fehlt für die fachliche Arbeit.
- Chancen:
- Die Stärkung der Freien Berufe auf Bundesebene.
- Freiberufliche Spezifika in europäische Richtlinien einbringen.
- Mehr Werben für die Freien Berufe auf europäischer Ebene.
- Die Akzeptanz Freier Berufe bei der EU-Kommission stärken.
- Perspektiven:
- Die Freien Berufe werden nicht als Hindernis für den Binnenmarkt gesehen, sondern als Garant für Qualität und effektiven Verbraucherschutz.
- Die Freien Berufe werden bei der Gesetzgebung besser in ihren Besonderheiten und Stärken berücksichtigt.
- Abbau unnötiger Bürokratie für Kleinunternehmen, die gerade Freiberuflerinnen und Freiberufler trifft.
- Weiterentwicklung der Berufsgesetze mit Augenmaß.
3.5 Nachhaltigkeit
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit steigt auch für die Freien Berufe. Ebenso wird die Rolle der Freien Berufe auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft wichtiger:
- Herausforderungen:
- Anpassung der Arbeitsweise an ökologische und soziale Anforderungen.
- Bewusstseinsbildung bei Auftraggeberinnen/Auftraggebern, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten für nachhaltiges Wirtschaften.
- Chancen:
- Entwicklung von nachhaltigen Praxis-, Büro- und Kanzleistrukturen.
- Nachhaltige Dienstleistungen und Beratungskonzepte werden von den Kundinnen und Kunden immer stärker nachgefragt und dementsprechend von den Büros angeboten.
- Perspektiven:
- Die Freien Berufe sind Ideengeber, Problemlöser und Partner bei der Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft.
3.6 Versorgung des ländlichen Raums
Niedersachsen ist ein Flächenland. Die Mehrheit der Niedersächsinnen und Niedersachsen lebt in kleinen Städten und Gemeinden. Dort sind die Freien Berufe ein wesentlicher Baustein des Alltags, des sozialen Zusammenhaltes und der Infrastruktur. Der Zugang zu den Dienstleistungen der Freien Berufe muss für alle gesichert sein, für die Menschen, kleine und mittlere Unternehmen und die Kommunen im ländlichen Raum:
- Herausforderungen:
- Rückgang der Selbstständigen seit 2000 betraf besonders den ländlichen Raum.4
- Abwanderung junger Fachkräfte in die urbanen Zentren.
- Die Suche nach einer/einem geeigneten Nachfolgerin/Nachfolger ist schwieriger als in den Städten.
- Digitale Infrastruktur: Eine schnelle Internetverbindung ist heute die Grundvoraussetzung für die Arbeit vieler freiberuflich Tätiger, von der Telemedizin bis zur digitalen Steuerberatung oder bei Architekturprojekten.
- Chancen:
- Freiberuflich Tätige können leichter als in den Städten eine stabile Beziehung zu ihren Auftraggeberinnen/Auftraggebern, Patientinnen/Patienten, Mandantinnen/Mandanten oder Klientinnen/Klienten aufbauen.
- Kosten für Wohn- und Praxisräume sind auf dem Lande niedriger als in urbanen Zentren.
- Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten für den Zugang zu Dienstleistungen Freier Berufe.
- Ökologische Nachhaltigkeit spricht für regionale Anbieter.
- Perspektiven:
- Schnelles Internet steht überall in Niedersachsen auch auf dem Lande zur Verfügung.
- Wohnen im ländlichen Raum wird als attraktiv wahrgenommen: Ländliche Regionen können mit ihrer Lebensqualität punkten, z. B. mit der Nähe zur Natur, bezahlbarem Wohnraum und vorhandenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
- Stärkung regionaler Anbieter durch regionale Nachfrage.
4 Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder“, 2023
3.7. Strukturelle Veränderungen innerhalb der Freien Berufe
In vielen Freien Berufen gibt es einen kontinuierlichen Trend hin zu größeren Büroeinheiten oder Niederlassungen mit mehreren Inhaberinnen oder Inhabern und zusätzlich angestellten Berufsträgerinnen und Berufsträgern. Dementsprechend steigt auch der Anteil der angestellten Freiberuflerinnen und Freiberufler immer mehr an. Diese Tendenz spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung und den Wunsch nach mehr Work-Life-Balance und stabilem Einkommen wider. Sie ist aber auch einer zunehmenden inhaltlichen Komplexität der Themen geschuldet, die eine arbeitsteilige Bearbeitung fördert und auch sinnvoll macht.
- Herausforderungen:
- Auch bei wachsenden Einheiten bleibt die persönliche Leistungserbringung ein wichtiges Strukturprinzip einer freiberuflichen Leistungserbringung; dies kann dem Wachstum auch Grenzen setzen.
- Auch angestellte Freiberuflerinnen und Freiberufler sind Angehörige eines Freien Berufs und damit den wesentlichen Grundsätzen verpflichtet. Kammern und Verbände müssen in ihrer Arbeit verstärkt die Themen und Anliegen der angestellten Mitglieder berücksichtigen.
- Chancen:
- Anstelle von größeren Büros können auch Arbeitsgemeinschaften geeignet sein, der zunehmenden Komplexität Rechnung zu tragen, ohne ihre Grundprinzipien außer Acht lassen zu müssen.
- Möglichkeit der Einbindung angestellter Freiberuflerinnen und Freiberufler in die Selbstverwaltung.
- Perspektiven:
- Kammern und Verbände fördern Arbeitsgemeinschaften, indem sie Netzwerkbildung organisieren und Muster-Vertragsgrundlagen für Arbeitsgemeinschaften erarbeiten.
- Die Rolle angestellter Freiberuflerinnen und Freiberufler wird stärker nach innen und außen kommuniziert. Kammern und Verbände beziehen die Interessen dieser Gruppe stärker in ihre Arbeit ein und ermöglichen, dass sie in den Kammergremien angemessen berücksichtigt werden.
4. Rahmenbedingungen und Ausblick für die Freien Berufe
Die freiberuflich Tätigen können ihre Aufgaben nur erfüllen und den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden, wenn ihnen die Kammern, die Berufsorganisationen und auch die Landespolitik die notwendigen Rahmenbedingungen bieten:
- Kammern und Verbänden kommt die Verantwortung zu, die Qualifikation der Freiberuflerinnen und Freiberufler im eigenen Mitgliederkreis sorgfältig zu überprüfen. Dies geschieht bei Kammern durch ein fachlich fundiertes Eintragungsverfahren und durch ggf. stichprobenartige, laufende Überprüfung von Fortbildungsverpflichtungen für die Mitglieder.
- Für Kompetenzen, die über einen generalistischen Anspruch hinausgehen, können spezifische Fachregister geführt werden.
- Kammern und Verbände widmen sich vermehrt der Nachwuchsgewinnung. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist es wichtig, das eigene Berufsfeld als attraktives Tätigkeitsfeld zu bewerben.
- Eine weitere Möglichkeit zur Sicherung des beruflichen Nachwuchses ist die Integration ausländischer Fachkräfte. Auch hier können die Berufsorganisationen eine wichtige Rolle spielen.
- Die berufsrechtliche Aufsicht über die Kammermitglieder sollte im Sinne eines effektiven Verbraucherschutzes ausgestaltet sein. Kammern und Verbände verstehen sich nicht nur als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für ihre Mitglieder, sondern auch für diejenigen, die die Leistungen der Kammermitglieder in Anspruch nehmen.
- Kammern und Verbände nehmen bei der Betreuung ihrer Mitglieder verstärkt insbesondere diejenigen in den Blick, die außerhalb der Ballungszentren tätig sind. Sie helfen bei der Vernetzung und bei der Fortbildung gerade dieser Mitglieder, um die Präsenz im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten.
- Die Landesregierung setzt sich auf europäischer Ebene für den Erhalt und für die Weiterentwicklung einer freiberuflichen Struktur in Niedersachsen ein.
- Die Landesregierung steht klar zur Selbstverwaltung und dem Ansatz, dass die freiberuflichen Werte wie Qualität, Unabhängigkeit und Sicherung des Gemeinwohls gestärkt werden müssen.
- Die Landesregierung eröffnet den Kammern in vielen Fällen den gesetzlichen Rahmen, um berufliche Standards sicherstellen und damit einen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten zu können.
- Die Übertragung weiterer Aufgaben auf die Kammern kann sinnvoll sein, um die Verwaltung subsidiär und staatsentlastend zu organisieren.
- Entbürokratisierung schafft eine wichtige Voraussetzung für die effektive Arbeit von Freiberuflerinnen und Freiberuflern.
5. Fazit
Dieses Leitbild basiert auf einem festen Fundament aus Werten, die das Handeln der Freien Berufe leiten. Diese sind gesellschaftliche Verantwortung, Unabhängigkeit in der Berufsausübung sowie Qualifikation/Kompetenz. Hinzu kommt Selbstverwaltung durch die Kammern.
Das vorliegende Leitbild zeigt auf, wie prägend die Freien Berufe mit ihrer Expertise, ihrer Innovationskraft und ihrem Engagement nicht nur als Arbeitgeberin/Arbeitgeber, sondern auch als unverzichtbare/r Dienstleisterin/Dienstleister für Menschen und Unternehmen hier bei uns in Niedersachsen sind.
Die Freien Berufe stehen aber auch vor einer Vielzahl von Herausforderungen wie dem demografischen Wandel, der Einführung neuer Technologien, der Transformation der Gesellschaft, der Sicherstellung der Versorgung des ländlichen Raums und nicht zuletzt der strukturellen Veränderungen innerhalb der Freien Berufe hin zu größeren Praxen/Kanzleien.
Die Freien Berufe in Niedersachsen müssen flexibel und zukunftsorientiert auf die beschriebenen Herausforderungen reagieren. Mit gezielten Maßnahmen und strategischen Weichenstellungen können sie nicht nur ihre eigene Stellung sichern, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung leisten.
Der Verband der Freien Berufe im Lande Niedersachsen e. V. und die Niedersächsische Landesregierung bekennen sich zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Zukunft der Freien Berufe in Niedersachsen. Sie appellieren an alle freiberuflich Tätigen und Stakeholderinnen und Stakeholder in Niedersachsen, die Prinzipien und Ziele dieses Leitbilds aktiv zu unterstützen.
Hannover, den 19. August 2025
Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Minister
für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Robert Marlow
Präsident des Verbandes der Freien Berufe im Lande Niedersachsen e. V. (FBN)
